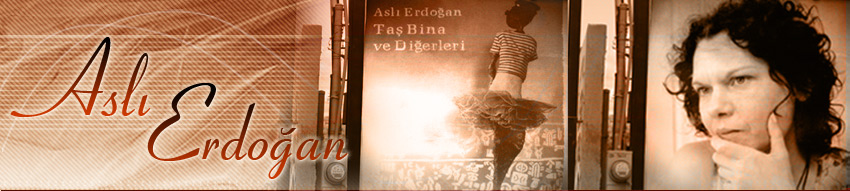Ohne Geld in Rio
Was macht eine Türkin in Rio? Endlich ist sie frei – zugleich isoliert. Sie verfällt der
Stadt und verfällt in ihr. Beeindru— ckend: „Die Stadt mit der roten Pelerine“ von Asli
Erdogan.
Was macht eine Tochter aus gutem türkischem Haus, Informatikerin und Physikerin mit
zweijährigem Praktikum bei Cern in Genf, in Rio de Janeiro? Eine Stadt, die einerseits als die
schönste der Welt gilt, andererseits von der Autorin als eine beschrieben wird, deren 600
Hügel von unzähligen Favelas in Beschlag genommen werden und in der Hunderttausende
Obdachlose wie verrostete Nägel, die man weggeworfen hat, in den Straßen verrotten. „Es ist
der Ort, wo naive, wohlmeinende und großzügige Organisationen versuchen, ein
ausgebeutetes, schlecht ernährtes Volk – vor wem? – zu schützen. Rio zwinkert nur teuflisch
mit den Augen und belächelt sie. Die Stadt weiß, dass sie schnell aufgeben und, nachdem sie
sich ein, zwei Punkte auf ihrem Gewissenskonto gutgeschrieben haben, wieder zurückkehren
werden in ihre wie ein Uhrwerk funktionierende, langweilige, mit Freud und Leid geizende
Erste Welt.“
Ist es das, was Özgür (özgür heißt so viel wie frei, unabhängig) in Rio festhält, nachdem sie
die Universität, die sie gerufen hat, verlässt und versucht, sich als Programmiererin,
Nachhilfelehrerin für Englisch und Tänzerin durchzuschlagen? Die Langeweile an der mit Freud
und Leid geizenden Ersten Welt, in der ihr eine große Karriere als Physikerin offengestanden
wäre? Oder doch die schmerzhafte Liebe zu einer Stadt, deren Geheimnis sie zuinnerst
herausfordert?
Was die Daten angeht, gleicht Özgürs Biografie der ihrer Autorin, der 1967 in Istanbul
geborenen Asli Erdogan, die Informatik und Physik ebenfalls aufgegeben hat und nach einem
zweijährigen Brasilienaufenthalt wieder in Istanbul lebt. Auch Özgür schreibt an einem Roman,
der als Roman im Roman kursiv gesetzt, parallel zur Geschichte von Özgür verläuft. Die Heldin
ihres Romans heißt Ö. Özgür verfällt der Stadt und verfällt in ihr. Mit beeindruckender
Hartnäckigkeit stellt sie die gewonnene Freiheit auf die Probe: „Ich bin allein in diesen
halbwilden Gegenden, bin alleine und habe dieses ganz neue Gefühl von Freiheit und
Isolation. Es ist eine absolute, eine infernalische Freiheit, niemanden zu haben, der meine
Bedürfnisse erahnt, ja nicht einmal einen Aufpasser zu haben. Ich kann irgendwelche Lügen in
die Welt setzen, ich kann mir die Vergangenheit so zurechtbiegen, wie sie mir passt, und ich
kann den sündigsten Fantasien nachhängen.“
Je mehr Özgür versucht zur Kernschicht dieser Stadt vorzudringen, um irgendwie
dazuzugehören, desto mehr fühlt sie sich zurückgewiesen. Ihr Portugiesisch wird immer
besser, aber man scheint sie immer weniger zu verstehen. Die Liebesabenteuer, auf die sie
sich einlässt, enden jeweils mit dem Verlassenwerden. Sie bleibt die Gringa, die Fremde, auch
wenn sie mittlerweile genauso mittellos ist wie die meisten Einheimischen. Sie hungert, bis
sich ihr Magen in Krämpfen windet, raucht eine Zigarette nach der andern, schnupft hin und
wieder Kokain, das in den Favelas wie Brausepulver verkauft wird, leidet unter der Hitze, unter
Nervenzusammenbrüchen und Asthmaanfällen. Und ist dennoch nicht bereit, nach Istanbul
zurückzukehren. Das Telefongespräch mit der Mutter fügt sich in eine Reihe von Gründen für
die Ablehnung. Die Mutter, eine wohlhabende Geschiedene, die daran denkt über Weihnachten
mit Freunden nach St. Petersburg zu fahren und die Tochter einlädt, sie zu begleiten, hat nicht
die geringste Ahnung, was die Tochter umtreibt, wirft ihr nur vor, ihre Zeit zu vergeuden und
sich darüber zu beklagen, dass sie kein Geld hat.
Eine klaffende Wunde am Nacken
Özgür klammert sich an ihren Roman, trägt das grüne Heft, in das sie ihn schreibt, mit sich
herum, um auch in Lokalen daran arbeiten zu können. Das lässt sie immer unnahbarer
erscheinen, auch wenn sie sich nach nichts mehr sehnt, als angenommen zu werden. Sie stellt
sich tapfer dem, was viele Menschen in Rio zu übersehen gelernt haben. Die schlafende
Mulattin am Straßenrand zum Beispiel. Özgür bemerkt, dass sie tot, und wie die klaffende
Wunde am Nacken beweist, auch noch ermordet worden ist. Sie begegnet einem auf dem
Boden liegenden Verhungernden, der zu erschöpft ist, um sein Erbrochenes noch einmal
hinunterzuschlingen und kann ihm nicht helfen. Es ist Weltmeisterschaft, der Kiosk ist
geschlossen, sie selbst hat auch kein Geld mehr. Und sie weiß, dass für den Verhungernden
jede Hilfe zu spät kommt.
Als ihr in einer Bank irrtümlich ein Teil des Geldes eines neben ihr anstehenden Lehrlings
ausgezahlt wird, nimmt sie es und geht damit davon. „Eine Weile drückte sie sich in den
Straßen herum wie ein entflohener Sträfling. Dann stürzte sie in das erstbeste italienische
Lokal und verschleuderte das ganze Geld für ein einziges Abendessen. Es gibt doch
Unverzichtbareres als Tugenden: die Zitrone im Tee, die Sonntagszeitung oder italienischen
Mozarella.“ So steht es in Ö.s Roman, gleich darauf kommentiert Özgür: „Das war vielleicht
das aufrichtigste Kapitel des Romans.“ Özgür hat in Rio die Freiheit gewählt und ist in der
Freiheit des Dschungels, der die Stadt noch immer umklammert hält, gelandet. Verarmt,
vereinsamt, seelisch und körperlich heruntergekommen, aber mit immer klarerem Blick auf
die Not, die Verzweiflung, die Grausamkeit, aber auch die Lust, die sie umgibt und der sie sich
nicht entziehen kann.
Noch in einem früheren Stadium, als sie mit einer Universitätskollegin nachts durch die Bars
zieht und erleben muss, wie Deborah, die sie für den Inbegriff des Weiblichen hält, ihr – wie in
einem Lehrstück über bewusst eingesetzte Verführungskunst – den einzigen Mann, mit dem
sie vielleicht eine nachhaltigere Beziehung hätte aufbauen können, nur so, zum Vergnügen,
wegschnappt, wird ihr schlagartig klar, wie unbarmherzig die Gelüste des Leibes sind, die
nirgendwo sonst mit solcher Lässigkeit ausgelebt werden wie in dieser Stadt.
All die extremen Erfahrungen, die sie in Rio gesucht und auch gemacht hat, möchte Özgür in
Worte fassen, sie in einer prägnanten, kunstvollen Sprache festschreiben, aus der Bilder
entstehen sollen, die das Festgeschriebene wiederum in Empfindbares auflösen. Doch kaum
glaubt sie, mit ihrem Roman dem Tod ihren ganz persönlichen Sieg abgerungen zu haben, fällt
dieser Sieg blitzschnell in sich zusammen. „Der Moment, in dem sie in den Kern der Wahrheit
eingedrungen war und die Unendlichkeit in ihren Händen gehalten hatte, war ihr schon längst
wieder zwischen den Fingern zerronnen. Das Leben hatte sich erneut in seinen Schleier
gehüllt, der aus verschiedenen Formen, Symbolen und Begriffen gewoben ist.“
Ein beeindruckendes Buch, das in seiner Entdeckungsbeharrlichkeit an die großen
Forschungsreisenden früherer Jahrhunderte gemahnt. ■
|